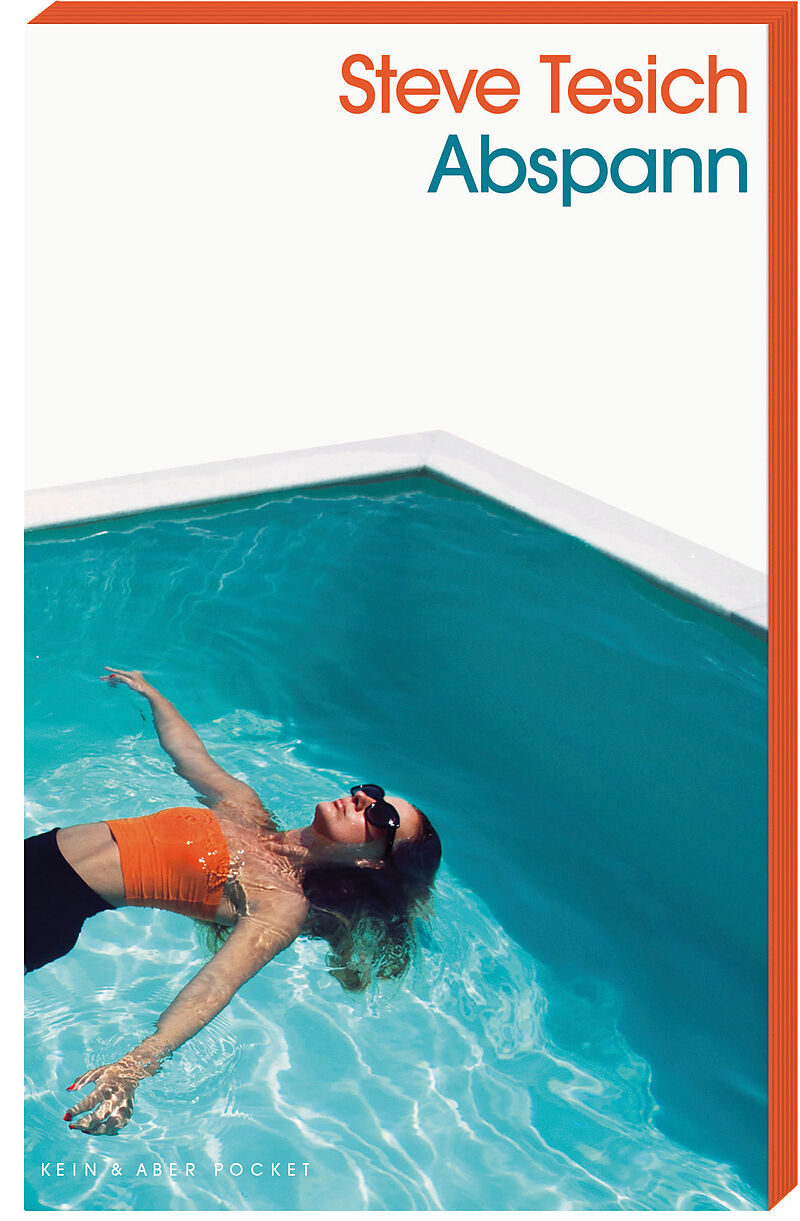

Abspann
Beschreibung
Eine traurig-witzige Geschichte über einen Skriptdoktor, der auch Kettenraucher, versoffener Hund, lausiger Ehemann, Vater und sehr zuverlässig darin ist, sich selbst ein Bein zu stellen. Saul Karoo ist in Hollywood ein gefragter Experte für das Umschreiben vo...Format auswählen
- Kartonierter Einband (Kt)CHF 18.80
- E-Book (epub)CHF 17.90
Wird oft zusammen gekauft
Andere Kunden kauften auch
Beschreibung
Eine traurig-witzige Geschichte über einen Skriptdoktor, der auch Kettenraucher, versoffener Hund, lausiger Ehemann, Vater und sehr zuverlässig darin ist, sich selbst ein Bein zu stellen.
Saul Karoo ist in Hollywood ein gefragter Experte für das Umschreiben von Drehbüchern: Er schneidet und poliert sie, bis sie funktionieren. Sein eigenes Leben hat er allerdings weit weniger unter Kontrolle. Doch dann erhält er einen besonderen Auftrag, der ihn zwingt, sein Glück in die Hand zu nehmen. Aber lässt sich die Realität genauso flicken wie ein Drehbuch?
Vorwort
Die rasante Geschichte über den Skriptdoktor Karoo bis aufs Blut bitter, schonungslos und intelligent
Autorentext
Steve Tesich wurde 1942 in Uice geboren und zog im Alter von vierzehn Jahren in den US-Bundesstaat Indiana. Er ist der Verfasser zahlreicher Stücke und Drehbücher sowie der beiden Romane "Ein letzter Sommer" und "Abspann". Steve Tesich starb 1996 im Alter von 53 Jahren.
Leseprobe
2
Bei den McNabs, George und Pat, war es Tradition, am Tag nach Weihnachten eine Party zu geben, aber noch nie hatten sich die Weltereignisse dazu verschworen, die Party so lebhaft und gegenwartsnah zu gestalten. Es gab viel zu feiern und zu bereden. Václav Havel, die Berliner Mauer, das Ende des Kalten Krieges, der Zusammenbruch des Kommunismus, Gorbatschow und, zumindest für die nächsten paar Tage, diese Rumänen mit ihren köstlich klingenden Namen.
Ich trank jetzt wieder Rotwein, wie schon gleich nach meiner Ankunft auf der Party. Dazwischen hatte ich sämtliche Arten alkoholischer Getränke konsumiert, die das Haus anbot. Weißwein, Bourbon, Scotch. Drei verschiedene Sorten Wodka. Zwei verschiedene Sorten Cognac. Champagner. Diverse Liköre. Grappa. Raki. Zwei Flaschen mexikanisches 10 Bier und mehrere Cocktailgläser Eierflip mit Rum. All das auf leeren Magen, und doch war ich zu meinem Leidwesen stocknüchtern.
Nichts.
Ich war nicht nur nicht betrunken, ich hatte nicht mal einen Schwips.
Nichts.
Überhaupt nichts.
Von Rechts wegen hätte ich auf einer Bahre liegen müssen, in einem rasenden Krankenwagen auf dem Weg zur Notaufnahme, wo man mich wegen schwerer Alkoholvergiftung behandeln würde, aber nein, ich war nüchtern. Staubtrockennüchtern. Klaren Kopfes. Vollkommen unversehrt. Nichts. Mein Alkoholproblem begann vor etwas über drei Monaten.
Ich hatte noch nie von jemandem mit dieser Krankheit gehört. Ich wusste nicht, wo und wie ich sie mir geholt hatte oder was der Auslöser war.
Ich wusste nur, dass etwas mit mir nicht stimmte. Etwas in mir war gerissen oder locker geworden oder abgegangen. Es war etwas Physiologisches oder Psychologisches oder Neurologisches, irgendwo im dunklen Innern meines Körpers oder meines Kopfes war irgendein kleines Blutgefäß geplatzt oder verstopft, war irgendeine Synapse durchgebrannt oder irgendein chemischer Prozess umgekippt, ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Ich wusste nur eines, der Zustand der Trunkenheit war aus meinem Leben verschwunden.
Meine Trinkerkrankheit führte wahrscheinlich, weil ich sie nicht wahrhaben wollte zu der seltsamen Begleiterscheinung, dass ich seit ich gemerkt hatte, ich konnte trinken, soviel ich wollte, ich wurde nicht betrunken nur umso mehr trank. Ich mochte gegen Alkohol immun geworden sein, 11 aber nicht gegen Hoffnung, und egal, wie hoffnungslos es aussah, ich fuhr fort, zu trinken und zu hoffen, dass ich eines schönen Abends, wenn ich es am allerwenigsten erwartete, wieder wie in der guten alten Zeit einen Rausch kriegen und in mein altes Ich schlüpfen würde.
Die Musik hörte auf. Die Platte wechselte, aber nicht der Komponist, und nach einem kurzen Zwischenspiel aus dem Lärm unbegleiteter menschlicher Stimmen war wieder Beethoven dran. Wie immer bei den McNabs war es eine Am- Tag-nach-Weihnachten-Beethoven-pur-Party.
Ich goss mir ein Glas Tequila ein, ein schönes großes für Mineralwasser vorgesehenes Glas, und leerte es.
Ich verstand das nicht. Beim besten Willen nicht. Blut war schließlich Blut, und wenn man es darauf anlegte und sicherging, dass der Alkoholgehalt des Blutes alle bekannten Maßstäbe der Trunkenheit um das Fünffache überstieg, dann müsste man in der Lage sein, betrunken zu werden. Ausnahmslos jeder. Es war eine Sache der Biologie. Und zwar nicht nur der menschlichen Biologie. Hunde konnten betrunken werden. Ich hatte von einem besoffenen Pitbull gelesen, der in der Bronx einen Obdachlosen angefallen hatte und dann wenige Querstraßen weiter umgekippt war. Später wurden ein paar Kids aus der Gegend festgenommen und beschuldigt, das Tier alkoholisiert zu haben. Pferde konnten betrunken werden. Kühe. Schweine. Es gab Alki-Ratten, die sich mit Schaumwein einen ansoffen. Elefantenbullen, da war ich sicher, konnten betrunken werden. Rhinozerosse. Walrosse. Hammerkopfhaie. Kein lebendes Geschöpf, ob Mensch oder Tier, war immun gegen Alkohol. Bis auf mich.
Gerade diese biologische Aussperrung, die unnatürliche Natur meines Gebrechens erfüllte mich mit Scham und dem Gefühl, gebrandmarkt zu sein, als hätte ich mich mit einer umgekehrten Aids-Variante infiziert und wäre gegen alles immun geworden. Aus Angst, zum Paria zu werden, falls meine Krankheit bekannt würde, tat ich so, als sei ich betrunken. Außerdem konnte ich es nicht ertragen, die Menschen, die mich kannten, zu enttäuschen. Sie erwarteten von mir, betrunken zu sein. Ich bildete den Kontrast, an dem sie ihre Nüchternheit messen konnten.
Aber meine Immunität gegen Alkohol, obschon äußerst beunruhigend, war nicht meine einzige Krankheit. Ich hatte noch andere. Viele, viele andere. Ich war ein kranker Mann.
Noch nie da gewesene Krankheiten mit bizarren Symptomen ließen sich in meinem Körper und in meinem Kopf häuslich nieder. Es war, als stünde ich in der Adressenkartei einer kosmischen Versandfirma für Krankheiten oder hätte in mir ein verhängnisvolles Gravitationsfeld, das unbekannte neue Krankheiten anzog.
3
Die McNabs, George und Pat, unsere Gastgeber, bewohnten eine labyrinthische Zimmerflucht im siebten Stock vom Dakota. Überall standen Pflanzen und Lampen. Quarzlampen. Tischlampen. Italienische Stehlampen mit Marmorsockeln. Frühe Tiffany-Lampen mit bunten Glasschirmen, bei Sotheby's ersteigert. Ein riesiger Kristallkronleuchter hing im riesigen Wohnzimmer, ein weiterer riesiger Kristallkronleuchter im riesigen angrenzenden Salon. Aber trotz dieses Leuchtkörperdeliriums hatte die Wohnung der McNabs etwas an sich, das Licht verschlang wie Venusfliegenfallen Insekten. Weit entfernt von sonniger Helligkeit, herrschte eine Atmosphäre düsterer Dämmerung.
In diesem Lärm aus Stimmengewirr und Musik und in diesem Zwielicht betrunken zu sein, war schlimm genug. Im gnadenlosen Griff unfreiwilliger Nüchternheit zu sein, war eine Qual.
»Auf die Freiheit!«, riefen George und Pat McNab und hielten ihre Champagnergläser hoch. »Auf die Freiheit überall! «, fügte Pat McNab hinzu, wobei ihre Stimme vor Gefühlsüberschwang brach.
»Auf die Freiheit!«, erwiderten alle, darunter auch ich. Wir tranken alle unsere jeweiligen Drinks aus. Meiner war ein weiterer Tequila.
Der riesige Weihnachtsbaum mindestens drei Meter hoch war ein Kronleuchter für sich. Seine zahllosen bunten Birnchen blinkten, so schien es, im Takt zu Beethovens Musik. Aus irgendeinem Grunde erinnerten der Weihnachtsbaum, die festlich gekleidete Menge, der Trinkspruch auf die Freiheit und die Kronleuchter an ein Kreuzfahrtschiff auf hoher See.
Wir würden bald die Dekade der Achtziger verlassen und in die »neuen fröhlichen Neunziger« segeln, wie jemand das bevorstehende Jahrzehnt getauft hatte. In unserem Kielwasser lagen der Zusammenbruch des Kommunismus, der Sturz diverser Tyrannen, und vor uns lag irgendeine neue Neue Welt. Irgendein neues Neuland. Eine vorzügliche Aufnahme von Beethovens Fünfter schmetterte aus den riesigen Bose-Boxen und begleitete unsere Kreuzfahrt. Man musste brüllen, um gehört zu werden, aber die Stimmung der Party war so a…
