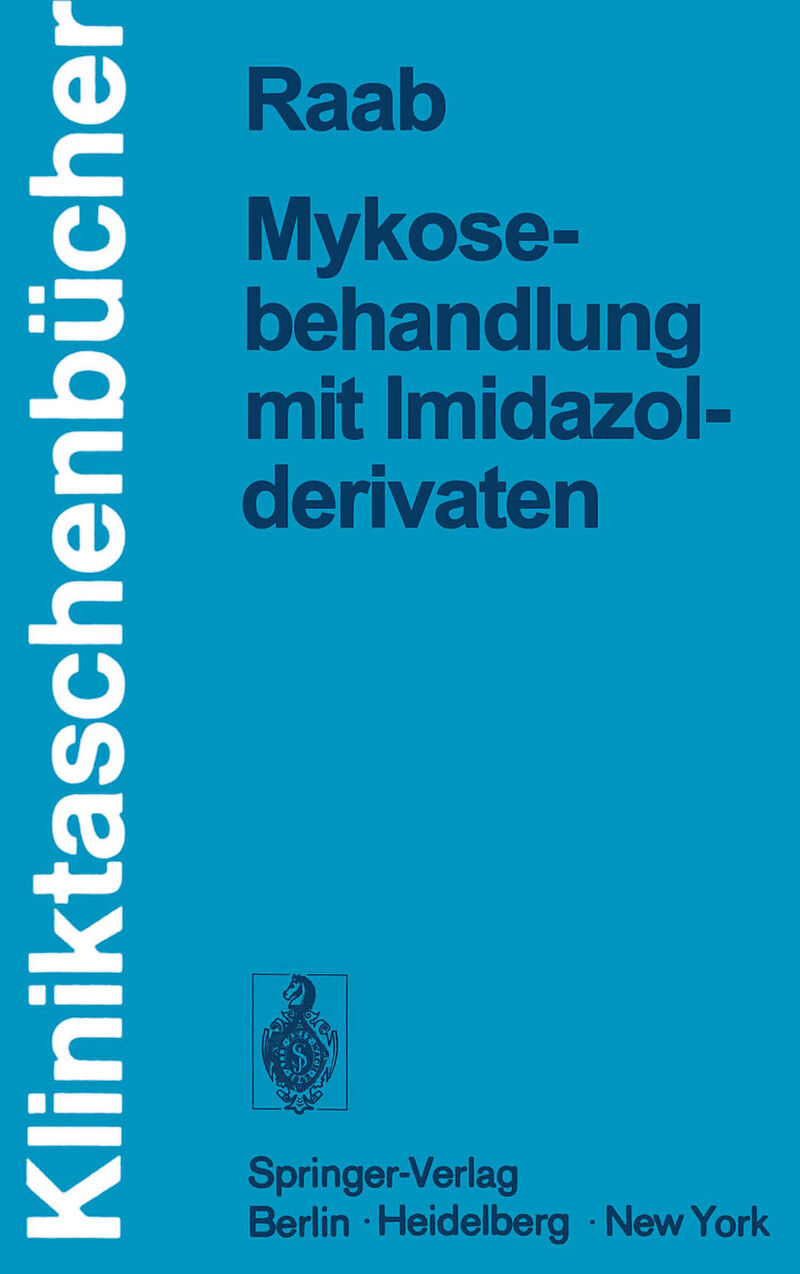

Mykosebehandlung mit Imidazolderivaten
Beschreibung
Spricht man von antimikrobieller Therapie, so wird dabei meist an antibakterielle Wirkstoffe gedacht, an die zahlreichen Antibiotika und Chemotherapeutika, die heute dem Arzt auf diesem Gebiet zur Verfiigung stehen. Richtet man jedoch den Blick auf die Moglich...Format auswählen
- Kartonierter EinbandCHF 63.20
- E-Book (pdf)CHF 46.90
Wird oft zusammen gekauft
Andere Kunden kauften auch
Beschreibung
Spricht man von antimikrobieller Therapie, so wird dabei meist an antibakterielle Wirkstoffe gedacht, an die zahlreichen Antibiotika und Chemotherapeutika, die heute dem Arzt auf diesem Gebiet zur Verfiigung stehen. Richtet man jedoch den Blick auf die Moglichkeiten der gegen Pilze gerichteten antimikrobiellen Therapie, so bietet sich ein vollig ande res und weit weniger erfreuliches Bild: Fiir die systemische Behand lung stehen zur Zeit insgesamt nur vier Wirkstoffe zur Verfiigung, und jeder dieser Wirkstoffe ist durch erhebliche Nachteile in seiner Anwendbarkeit beschrankt. Auf der anderen Seite wird eine groBe Zahl von Antimycetika fiir die exteme Therapie angeboten. Dermatologen und Gyniikologen setzen heute verschiedenste Wirk stoffe zur Mykosebehandlung ein, aber noch immer fehlen optimale Chemotherapeutika, die die Eigenschaften: hoher Wirkungsgrad, breites Wirkungsspektrum, geringe Toxizitiit, gute Bioverfiigbarkeit bei topischer wie systemischer Anwendung und geringe Neigung zur Induktion von Erregerresistenzen oder abbauenden Enzymen beim behandelten Patienten in sich vereinen. In den letzten J ahren hat es jedoch immer mehr AnlaB gegeben zu hoffen, daB uns bald ein Anti mycetikum zur Verfiigung steht, daB die geforderten Eigenschaften zumindest zum groBten Teil besitzt. Diese Hoffnung wird durch die Erfahrungen mit den neu entwickelten Antimycetika aus der Reihe der Imidazolderivate begriindet. Ais experimentell und praktisch-klinisch tiitiger Dermatologe, bzw. Dermato-Pharmakologe hat sich W. Raab mit den Problemen der topischen antimikrobiellen Therapie durch viele Jahre beschiiftigt.
Autorentext
Univ.Prof. Dr. Wolfgang Raab ist Facharzt für Dermatologie, Facharzt für Labormedizin. Em. Sachverständiger für Dermatologie und kosmetische Medizin. Gründer und langjähriger ärztlicher Leiter des Allergie-Ambulatoriums Innere Stadt
Inhalt
1 Einleitung.- 1.1 Allgemeines zur antimikrobiellen Therapie.- 1.2 Mikrobielle Erkrankungen von Haut und Schleimhaut.- 1.3 Antimikrobielle Wirkstoffe zur lokalen Anwendung.- 2 Breitspektrumantimikrobika zur lokalen Anwendung.- 2.1 Vorbemerkungen.- 2.2 Desinfizientien und Antiseptica.- 2.3 Antibiotica.- 2.4 Chemotherapeutica.- 2.5 Antimikrobiell wirksame Imidazolderivate.- 3 Econazol.- 3.1 Allgemeines.- 3.2 Chemische Struktur.- 3.3 Physikalische Eigenschaften.- 3.4 Antimikrobielles Spektrum.- 4 Allgemeine Mikrobiologie der Imidazolderivate zur lokalen Anwendung.- 4.1 Vorbemerkungen.- 4.2 Wirkungsweise.- 4.3 Resistenz und Toleranz.- 4.4 Wechselwirkungen mit anderen Verbindungen.- 4.5 Untersuchungen zur Bioverfügbarkeit.- 5 Therapeutischer Einsatz der Imidazolderivate zur Behandlung von Mykosen beim Tier (experimentelle Therapie).- 5.1 Lokale Anwendung.- 5.2 Systemische Anwendung.- 6 Allgemeine Pharmakologie der Imidazolderivate bei Mensch und Tier.- 6.1 Pharmakologische Eigenschaften (ohne antimikrobielle Wirkungen).- 6.2 Absorption, Exkretion und Metabolisierung bei Tieren.- 6.3 Absorption, Exkretion und Metabolisierung beim Menschen.- 6.4 Sensibilisierung.- 6.5 Anaphylaktoidie.- 7 Toxikologie der Imidazolderivate.- 7.1 Vorbemerkungen.- 7.2 Systemische Toxizität.- 7.3 Lokale Toxizität.- 8 Klinische Pharmakologie topischer Antimikrobika unter besonderer Berücksichtigung der Imidazolderivate.- 8.1 Vorbemerkungen.- 8.2 Physikalische Eigenschaften.- 8.3 Hautverträglichkeit.- 8.4 Sensibilisierung.- 8.5 Lichtreaktionen.- 8.6 Wechselwirkungen mit Substanzen der Hautoberfläche.- 8.7 Penetration und Absorption.- 8.8 Systemische Anwendung.- 8.9 Anwendung in der Tiermedizin und in der Lebensmittelindustrie.- 8.10 Spezielle klinisch-pharmakologische Gesichtspunkte bei lokalanwendbaren Antimikrobika.- 8.11 Klinische Pharmakologie der Präparation.- 9 Mikrobielle Infektionen des Menschen.- 9.1 Allgemeines.- 9.2 Zunahme mikrobieller Infektionen an Körperoberflächen.- 9.3 Saprophyten und Parasiten auf Körperoberflächen.- 9.4 Misch- und Doppelinfektionen auf Körperoberflächen.- 10 Mykosen.- 10.1 Entstehung von Mykosen.- 10.2 Zunahme von Mykosen.- 10.3 Einteilung der Mykosen.- 10.4 Haut- und Schleimhautmykosen.- 10.5 Mykosen des weiblichen Genitales.- 10.6 Systemmykosen.- 10.7 Allgemeines zur Mykosebehandlung.- 11 Systemische Anwendung der antimycetisch wirksamen Imidazolderivate beim Menschen.- 12 Lokale Anwendung der antimycetisch wirksamen Imidazolderivate beim Menschen.- 12.1 Anwendung auf der äußeren Haut.- 12.2 Anwendung auf Schleimhäuten.- 13 Kombinierte Anwendung von Imidazolderivaten und Glucocorticoiden zur lokalen Behandlung von Hauterkrankungen.- 13.1 Vorbemerkungen.- 13.2 Kombination von Antibiotica mit Glucocorticoiden.- 13.3 Salicylsäure, Haloprogin, Clioquinol, Chlorquinaldol und Triclosan.- 13.4 Imidazolderivate und Glucocorticoide.- 13.5 Indikationen für den kombinierten Einsatz von Imidazolderivaten und Glucocorticoiden.- 14 Wertung der Mykosen in verschiedenen Fachgebieten.- 14.1 Dermatologie.- 14.2 Gynäkologie.- 14.3 Kinderheilkunde.- 14.4 Stomatologie.- 14.5 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.- 14.6 Augenheilkunde.- 14.7 Proktologie.- 14.8 Urologie.- 14.9 Innere Medizin.- 14.10 Orthopädie.- 14.11 Chirurgie-Intensivpflege-Anaesthesiologie.- 15 Schlußbetrachtungen.- 16 Literatur.- 17 Sachverzeichnis.